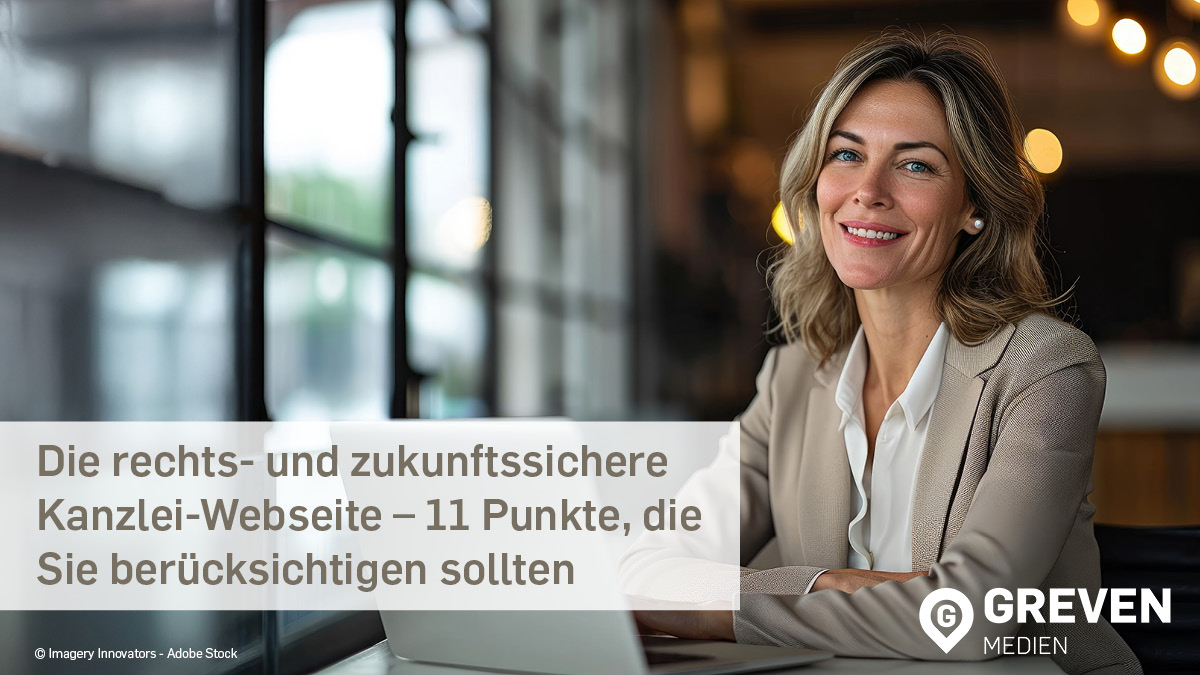Die rechts- und zukunftssichere Kanzlei-Webseite –
11 Punkte, die Sie berücksichtigen sollten
Eine rechtssichere Webseite ist unerlässlich, um rechtliche Risiken im täglichen Business zu minimieren. Eine Studie des FdWB von 2.500 Webseiten zeigt, dass 41% der deutschen Webseiten nicht sicher sind*.
Auch für Rechtsanwälte und Kanzleien ist es wichtig, bei der Gestaltung der Webseite die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten, um keine unnötigen Abmahnungen oder Bußgelder zu riskieren. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche rechtlichen Anforderungen bestehen und wie Sie Ihre Kanzlei-Website rechtssicher gestalten.
1. HTTPS-Verschlüsselung
Eine sichere HTTPS-Verschlüsselung gehört mittlerweile zum Standard für Webseiten, die personenbezogene Daten verarbeiten. Sie schützt die Kommunikation zwischen Nutzer und Webseite vor dem Abfangen durch Dritte. Gemäß Art. 32 DSGVO sind Webseitenbetreiber verpflichtet, angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Daten zu ergreifen. Die Nichtnutzung von HTTPS kann daher ein Verstoß gegen die DSGVO sein und Bußgelder nach sich ziehen.
Darüber hinaus werden Webseiten ohne HTTPS von Google als unsicher eingestuft und nicht angezeigt, wenn man sie im z. B. im Chrome-Browser aufruft. Dies kann zu einem Vertrauensverlust führen, noch bevor ein potenzieller Mandant die Möglichkeit hat, sich über die von der Kanzlei angebotenen Leistungen zu informieren.
2. Impressumspflicht
Die Pflicht zur Angabe eines Impressums regelt § 5 Digitale-Dienste-Gesetz (DDG). Für Rechtsanwälte kommen zusätzlich die Vorschriften der §§ 1-3 der Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung (DL-InfoV) hinzu. Notwendige Angaben sind unter anderem:
• Name und Anschrift des Anbieters
• Kontaktinformationen (E-Mail, Telefonnummer)
• Rechtsform und Vertreter
• Angaben zur zuständigen Aufsichtsbehörde
• Register und Registernummer
• Berufsspezifische Angaben wir Kammer & Berufsbezeichnung
• Umsatzsteuer-ID/Wirtschafts-ID
Ein Urteil des OLG Frankfurt a. M. vom 14.03.2017, Az. 6 U 44/16 bestätigte, dass ein fehlerhaftes oder unvollständiges Impressum als Wettbewerbsverstoß abmahnbar ist.
3. Datenschutzerklärung
Die Vorschriften zur Datenschutzerklärung finden sich in der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), insbesondere in Art. 13 und 14 DSGVO. Diese Artikel schreiben vor, dass Webseitenbetreiber ihre Nutzer klar und verständlich darüber informieren müssen, welche personenbezogenen Daten gesammelt werden und wie sie verarbeitet werden.
Weitere wichtige Inhalte der Datenschutzerklärung sind:
• Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter
• Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
• Hinweise auf die Weitergabe von Daten an Dritte (z.B. Hosting-Provider)
• Rechte der Betroffenen (z.B. Auskunft, Löschung)
• Informationen zu Cookies und Tracking-Tools
Eine fehlende oder unzureichende Datenschutzerklärung kann gemäß Art. 83 Abs. 5 DSGVO mit hohen Bußgeldern geahndet werden.
Rechtsanwälte sollten außerdem die besonderen Anforderungen an den Umgang mit Mandantendaten beachten, die strengen Vertraulichkeitsregeln unterliegen.
4. Cookie-Banner
Seit dem Urteil des EuGH (Az. C-673/17, „Planet49“) müssen Webseitenbetreiber beim Einsatz von Cookies die aktive Einwilligung der Nutzer einholen. Dies gilt besonders für Tracking-Cookies, die nicht technisch notwendig sind. Ein einfaches Hinweis-Banner reicht nicht aus. Der Nutzer muss die Möglichkeit haben, einzelne Cookies oder mit einem Klick alle Cookies abzulehnen. Auch die Option, eine erteilte Einwilligung zu widerrufen, muss gegeben sein. Verstöße gegen diese Vorschriften können gemäß Art. 83 Abs. 5 DSGVO ebenfalls mit Bußgeldern geahndet werden.
5. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Falls über die Webseite Dienstleistungen oder digitale Produkte angeboten werden, sind AGB unerlässlich. Diese regeln die Vertragsbedingungen und schaffen Klarheit über Rechte und Pflichten beider Seiten. AGB sollten folgende Punkte beinhalten:
• Vertragsschluss
• Zahlungsmodalitäten
• Haftungsbeschränkungen
• Widerrufsrecht
Die gesetzlichen Grundlagen finden sich in den §§ 305 ff. BGB (Bürgerliches Gesetzbuch). Dort ist festgelegt, dass AGB nur dann wirksam sind, wenn sie transparent und verständlich formuliert sind (§ 307 BGB). Es ist daher auch für Kanzleien ratsam, ihre AGB rechtlich überprüfen zu lassen, um mögliche Konflikte zu vermeiden.
6. Rechtswidrige Werbeaussagen
Kanzleien dürfen auf ihrer Webseite für ihre Dienstleistungen werben, doch es gilt Vorsicht: Werbeaussagen dürfen nicht irreführend oder übertrieben sein. Geregelt wird die im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), insbesondere §§ 5 und 5a UWG verbieten irreführende oder unwahre Angaben. Diese könnte als unlautere Werbung eingestuft werden und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Beispiele für unzulässige Werbung wären:
• Überzogene Erfolgsaussichten bei rechtlichen Auseinandersetzungen
• Garantien, die nicht haltbar sind
Besondere Vorsicht ist bei der Darstellung von Referenzen oder der Verwendung von Auszeichnungen geboten. Diese müssen nachvollziehbar und überprüfbar sein.
7. Urheberrecht bei der Nutzung von Bild- und Videomaterial
Für die Verwendung von Bildern und Videos auf der Webseite gilt das Urheberrechtsgesetz (UrhG). Gemäß § 15 UrhG darf urheberrechtlich geschütztes Material nur mit Zustimmung des Rechteinhabers genutzt werden. Fehlt diese Zustimmung, drohen Abmahnungen und Schadensersatzforderungen. Rechtsanwälte und Kanzleien sollten daher:
• Auf lizenzfreie Bilder zurückgreifen
• Bei Stockbildern die Lizenzbedingungen genau prüfen
• Urheber und Quelle der Bilder angeben
• Bei selbst erstelltem Material die Zustimmung aller abgebildeten Personen einholen (Recht am eigenen Bild)
8. Markenrecht
Die Nutzung von Logos, Firmennamen oder Marken kann problematisch sein, wenn diese rechtlich geschützt sind. Insbesondere dann, wenn ein fremdes Logo auf der eigenen Webseite ohne Zustimmung des Inhabers verwendet wird. Kanzleien sollten sicherstellen, dass sie:
• Eigene Logos und Marken schützen lassen
• Bei der Nutzung fremder Marken und Logos die Genehmigung einholen
Eine Verletzung des Markenrechts kann zu Schadensersatzforderungen führen und das eigene Image schädigen.
9. Disclaimer – Haftungsausschluss
Ein Disclaimer kann die Haftung für fremde Inhalte begrenzen, ist jedoch kein Freibrief. Er sollte klarstellen, dass der Betreiber für externe Links und nutzergenerierte Inhalte keine Verantwortung übernimmt. Ein Beispiel: “Für den Inhalt verlinkter Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.”
10. Social Media Buttons
Der Einsatz von Social Media Buttons muss unter Berücksichtigung der Datenschutzvorgaben erfolgen. Das Landgericht Düsseldorf entschied in einem Urteil (Az. 12 O 151/15), dass das bloße Einbinden von Social Media Plugins, die Daten ohne Einwilligung des Nutzers übertragen, gegen die DSGVO verstößt. Abhilfe schafft die Implementierung datenschutzkonformer Lösungen wie der „Zwei-Klick-Lösung“, bei der der Nutzer aktiv zustimmen muss, bevor eine Verbindung zu den Netzwerken hergestellt wird.
11. Barrierefreiheit
Barrierefreiheit bedeutet, dass Webseiten für alle Menschen zugänglich und nutzbar sind, unabhängig von ihren körperlichen oder technischen Fähigkeiten. Dies umfasst Menschen mit Seh- oder Hörbehinderungen, motorischen Einschränkungen oder kognitiven Beeinträchtigungen. Barrierefreiheit heißt auch, dass Webseiten auf älteren Geräten oder bei langsamer Internetverbindung noch funktionieren. Dabei gilt es, die folgenden Kriterien zu berücksichtigen:
• Wahrnehmbarkeit
• Bedienbarkeit
• Verständlichkeit
• Kompatibilität
In Deutschland sind vor allem öffentliche Stellen zur Barrierefreiheit ihrer Webseiten verpflichtet. Dazu gehören Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden. Die gesetzliche Grundlage bildet das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) und die Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0). Ab dem 28. Juni 2025 gilt zudem das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG), das die EU-Richtlinie des European Accessibility Act (EAA) umsetzt. Dieses Gesetz verpflichtet auch private Anbieter von Dienstleistungen und Produkten einiger Branchen zur Barrierefreiheit ihrer digitalen Angebote. Rechtsanwaltskanzleien sind Sie in der Regel nicht gesetzlich verpflichtet, Ihre Webseite barrierefrei zu gestalten, doch das kann sich in Zukunft noch ändern. Eine barrierefreie Webseite ist also auf jeden Fall empfehlenswert, da so die allgemeine Nutzererfahrung verbessert, eine breitere Mandantschaft erreicht und das rechtliche Risiko minimiert wird.
Fazit
Für Rechtsanwälte und Kanzleien ist es entscheidend, eine rechtssichere Webseite zu betreiben, um rechtliche Risiken zu minimieren und die eigene Professionalität und Vertrauenswürdigkeit zu wahren. Mit einer sicheren Verschlüsselung, einem korrekten Impressum, einer DSGVO-konformen Datenschutzerklärung nebst Cookie-Banner, ordnungsgemäßen AGB und der Einhaltung des Urheber- und Markenrechts legen Kanzleien die Grundlage für eine sichere Online-Präsenz. Barrierefreiheit macht eine Kanzlei-Webseite zukunftssicher. Es empfiehlt sich, diese Punkte regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls an neue rechtliche Entwicklungen anzupassen.
________________________
*Studie des FdWB (Fachverbands deutscher Webseitenbetreiber) https://fdwb.de/studie-des-fdwb-von-2-500-webseiten-2020/
Ihr Ansprechpartner:
Unsere Verkaufsleiterin und Expertin im Bereich Kanzleimarketing Ute Hermel berät Sie ebenso kompetent wie charmant.

Tel. 0221 / 2033 413
E-Mail
www.greven.de